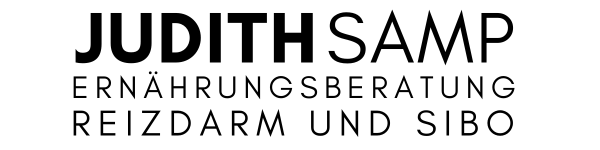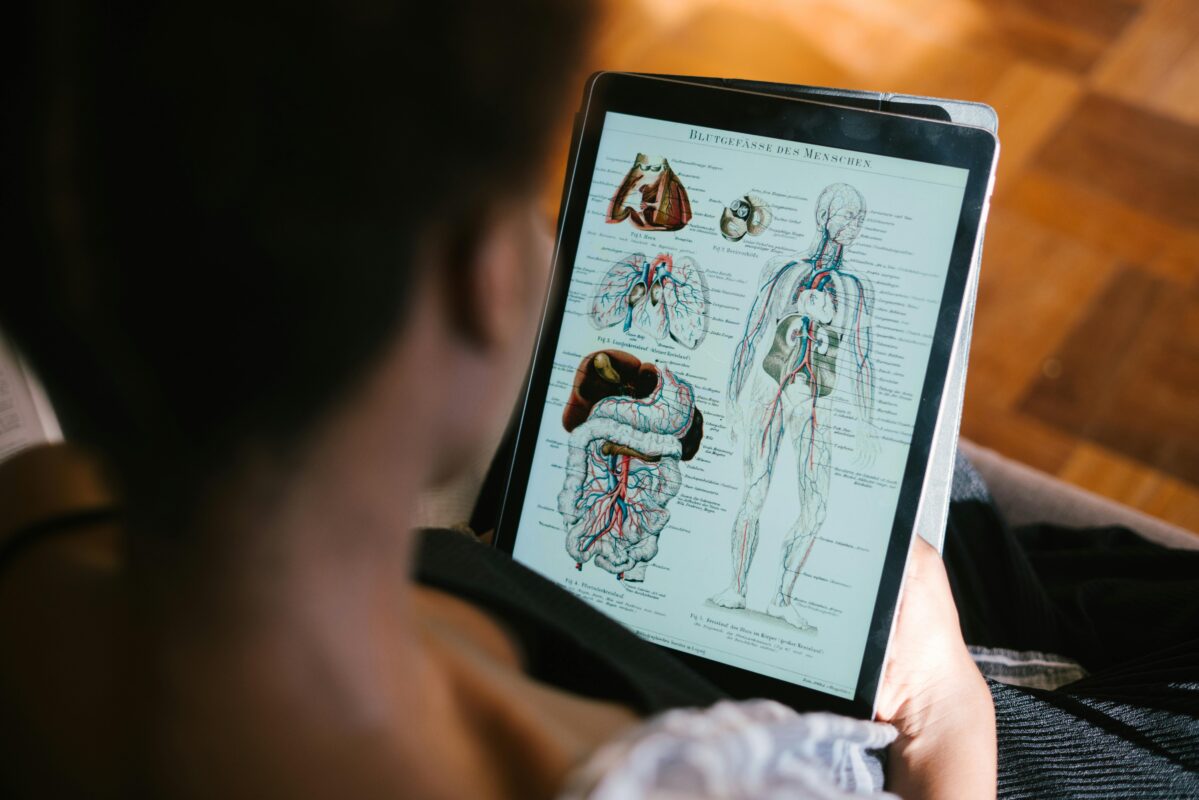Die Bauchspeicheldrüse – medizinisch Pankreas – ist ein zentrales Verdauungsorgan mit hormoneller (endokriner) und enzymatischer (exokriner) Funktion. Insbesondere Letzteres spielt eine entscheidende Rolle für die gesunde Verdauung und die Zusammensetzung der Dünndarmflora. Eine exokrine Pankreasinsuffizienz (EPI) führt zu einer eingeschränkten Produktion von Verdauungsenzymen, wodurch sich die Nahrungsbestandteile schlechter aufspalten lassen. Diese Verdauungsstörung kann das Risiko für SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth) deutlich erhöhen. In diesem Artikel beleuchten wir die medizinischen Zusammenhänge zwischen Pankreasfunktion und Dünndarmbesiedlung, wie sich eine EPI auf die intestinale Mikrobiota auswirkt und was dies für Diagnose und Therapie bedeutet.
Medical Disclaimer: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und ersetzt keine medizinische Beratung. Konsultiere immer einen Arzt oder Therapeuten, bevor du eine neue Behandlung ausprobierst.
Die exokrine Funktion des Pankreas: Enzyme für den Dünndarm
Das Pankreas sezerniert täglich rund 1,5 Liter Verdauungssekret in den Zwölffingerdarm. Diese Flüssigkeit enthält:
- Amylasen für die Kohlenhydratverdauung
- Lipasen für die Fettverdauung
- Proteasen (Trypsin, Chymotrypsin, Elastase) für die Eiweißverdauung
- Bikarbonat, um den sauren Speisebrei aus dem Magen zu neutralisieren
Diese Enzyme wirken im Duodenum und oberen Jejunum – also exakt dort, wo bei SIBO eine bakterielle Überwucherung pathologisch ist. Wenn diese Enzyme fehlen oder zu wenig vorhanden sind, bleiben Nahrungsbestandteile teilweise unverdaut. Die Folge: Sie dienen Bakterien als Nahrung – was eine Überwucherung im Dünndarm begünstigt.
Exokrine Pankreasinsuffizienz (EPI) als Risikofaktor für SIBO
Eine EPI liegt vor, wenn weniger als 10 % der normalen Pankreas-Enzymmenge produziert wird. Diese kann durch verschiedene Ursachen ausgelöst werden:
- Chronische Pankreatitis
- Mukoviszidose
- Diabetes mellitus (v. a. Typ 1)
- Alkoholabusus
- Pankreaskarzinom
- Nach operativer Entfernung des Pankreas (z. B. Whipple-OP)
Eine verminderte Enzymzufuhr führt zu Malverdauung, also inkompletter Aufspaltung von Makronährstoffen. Besonders Fette werden unzureichend resorbiert – es entsteht Steatorrhoe (Fettstuhl). Der Nahrungsbrei bleibt länger im Darm, die Transitzeit verlangsamt sich, es kommt zu vermehrter Fermentation durch Bakterien. Studien zeigen, dass bis zu 65 % der Patienten mit EPI eine bakterielle Dünndarmfehlbesiedlung aufweisen [1].
Ein weiterer Faktor ist die mangelnde Bikarbonat-Sekretion, wodurch die Magensäure im Duodenum nicht ausreichend neutralisiert wird. Das beeinträchtigt nicht nur die enzymatische Aktivität, sondern kann auch die Schleimhaut schädigen und die natürliche Barrierefunktion des Darms stören – was wiederum die Besiedelung mit übermäßigen Bakterien erleichtert.
Mikrobiologische Folgen von EPI: Milieustörung und Bakterienwachstum
In einer gesunden Umgebung halten verschiedene Faktoren das bakterielle Wachstum im Dünndarm in Schach:
- ausreichende Enzymtätigkeit
- normale Darmmotilität
- intakter Gallensäurefluss
- saurer pH im Magen und leicht alkalischer pH im Duodenum
Bei EPI verschieben sich diese Bedingungen. Die nicht-verdaute Nahrung führt zu erhöhtem osmotischen Druck, mehr Substraten für Fermentation, verändertem pH-Wert und vermehrter Gasbildung. Es zeigen sich typische Symptome von SIBO:
- Blähungen
- Bauchschmerzen
- Durchfall oder Fettstuhl
- Übelkeit, Völlegefühl
- Malabsorption fettlöslicher Vitamine (A, D, E, K)
Die dabei übermäßig vertretenen Bakterien sind oft aus der Gruppe der Enterobakterien (z. B. E. coli), aber auch anaerobe Arten, wie Bacteroides oder Clostridien, können sich überwuchern.
Diagnostik: Wie erkennt man EPI und SIBO?
Während sich SIBO über Atemtests (z. B. Laktulose- oder Glukose-Atemtest) feststellen lässt, erfolgt die Diagnostik einer exokrinen Pankreasinsuffizienz hauptsächlich über:
- Elastase-1 im Stuhl: < 200 µg/g gilt als Hinweis auf EPI
- Pankreatische Funktionstests (z. B. Sekretin-Pankreozymin-Test)
- Bildgebung: Sonografie, MRT, Endosonografie zur Beurteilung des Pankreas
- Fettbestimmung im Stuhl: bei Verdacht auf Steatorrhoe
Im klinischen Alltag sind ein niedriger Elastasewert und passende Symptomatik (v. a. Fettstühle, Gewichtsverlust, Blähungen) oft ausreichend für die Diagnose.
Therapieansatz: Ganzheitliche Behandlung von EPI und SIBO
Eine Kombinationstherapie ist in der Regel erforderlich. Diese umfasst:
1. Pankreasenzyme substituieren
- Gabe von Pankreatin (z. B. Kreon®, Pangrol®) in magensaftresistenter Form
- Dosierung angepasst an Fettgehalt der Mahlzeit (i.d.R. 25.000–50.000 Lipase-Einheiten pro Hauptmahlzeit)
- Einnahme während der Mahlzeit
Ziel ist es, die Verdauung zu normalisieren und den bakteriellen Substratüberschuss zu reduzieren.
2. SIBO behandeln
- Rifaximin: lokal wirkendes Antibiotikum (400 mg 3× täglich für 10–14 Tage)
- bei Methan-positivem SIBO ggf. Kombination mit Neomycin oder pflanzlichen Mitteln (z. B. Allicin, Oregano-Extrakt)
- im Anschluss: Motilitätsförderung (z. B. mit Iberogast, low-dose Erythromycin, Prucaloprid)
3. Ernährungsanpassung
- Reduktion von FODMAPs für symptomatische Entlastung
- moderate Fettzufuhr
- kleine, gut verdauliche Mahlzeiten
4. Supplementierung von Mikronährstoffen
- fettlösliche Vitamine (A, D, E, K)
- Zink, Magnesium, Vitamin B12 (bei Resorptionsstörung)
Fazit: Die Bauchspeicheldrürse darf bei SIBO nicht vergessen werden
Ein gesunder Dünndarm braucht eine funktionierende exokrine Pankreasfunktion. Fehlen die entscheidenden Verdauungsenzyme, ist das Milieu für Bakterienwachstum günstiger. SIBO und EPI sind deshalb oft zwei Seiten derselben Medaille. In der Praxis bedeutet das: Bei Verdacht auf SIBO sollte immer auch die Pankreasfunktion überprüft werden. Umgekehrt ist bei EPI ein Atemtest auf SIBO sinnvoll, wenn trotz Enzymsubstitution Beschwerden bestehen bleiben. Nur eine ganzheitliche Therapie, die beide Aspekte berücksichtigt, kann den Kreislauf aus Malverdauung, Fehlbesiedlung und Nährstoffmangel nachhaltig durchbrechen.
Quellen:
- Keller J, Layer P. „Human pancreatic exocrine response to nutrients in health and disease“. Gut. 2005.
- Gasbarrini A, Corazza GR, Gasbarrini G et al. „Small intestinal bacterial overgrowth in irritable bowel syndrome: a review.“ Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2009.
- Owyang C, DiBaise JK. „Intestinal microbiota and chronic gastrointestinal disorders“. Gastroenterology. 2011.
- Majumder S, Chari ST. „Chronic pancreatitis.“ Lancet. 2016.
- Such J, Frances R, Muñoz C, Zapater P, Casellas JA, Pascual S, et al. „Detection and identification of bacterial DNA in patients with cirrhosis and culture-negative, nonneutrocytic ascites.“ Hepatology. 2002.
- Ghoshal UC, Ghoshal U. „Small intestinal bacterial overgrowth and other intestinal disorders.“ Trop Gastroenterol. 2017.